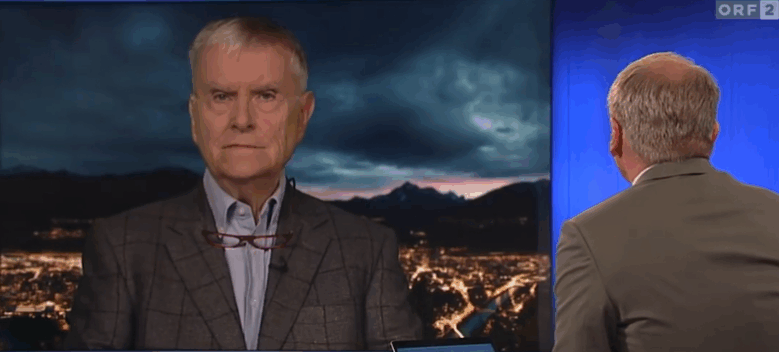Ich habe X jetzt angezeigt.
Ich weigere mich einfach, zu akzeptieren, dass X (vormals Twitter), eine der größten und einflussreichsten Social-Media-Plattformen der Welt, einschlägige Gesetze in Österreich und der EU nicht nur ignoriert, sondern ganz offen verhöhnt und sich der Justiz entzieht.
Die Vorgeschichte, die ich hier ausführlich erzählt habe, nochmal ganz kurz: Ein durchgeknallter Troll hat auf X jahrelang unter falschen Namen einen Account betrieben, auf dem er Tag für Tag Dutzende klagsfähige Postings veröffentlichte. Praktisch jedes Tweet war eine Beleidigung, Verleumung, üble Nachrede oder Kreditschädigung. Einige davon betrafen auch mich.
Jedes einzelne Posting verstieß auch gegen die X-internen Richtlinien. Trotzdem weigerte sich die Plattform auch nach mehrfacher Aufforderung, die Postings zu löschen. Einen Antrag des Straflandesgericht Wien, die Nutzerdaten des Trolls herauszugeben, um ihn (als medienrechtlich Verantwortlichen) klagen zu können, ignorierte das Unternehmen.
X verlangte ein offizielles Rechtshilfeansuchen an die Republik Irland (wo die europäische Firmenzentrale sitzt), das dann aber mit der bizarren Begründung abgelehnt wurde, die Nutzerdaten würden nicht innerhalb der EU gespeichert. Wir mögen uns an die US-Justiz wenden. Aber auch dort wurde ein Rechtshilfeansuchen abgelehnt. Begründung: man wäre leider überlastet und die Straftat nicht schwer genug.
Bliebe die Möglichkeit, nicht den Verfasser der Hass-Postings zu klagen, sondern X. Die Plattform ist zwar absurderweise nicht für die Postings verantwortlich, die sie veröffentlicht, wohl aber für jene, die sie trotz Aufforderung nicht löscht.
Meine Lust auf das Prozess- und Kostenrisiko gegen einen Milliardenkonzern mit riesiger Rechtsabteilung und einer Advokaten-Armee ist allerdings endenwollend. Und damit wäre die Sache (die bis dahin der großartige Dornbirner Rechtsanwalt Philipp Längle durchgefochten hatte), an dieser Stelle leider zu Ende gewesen. Was doch einigermaßen frustierend war.
Das sah auch Längles Wiener Kollegin Maria Windhager so – und möchte doch noch weitere rechtliche Möglichkeiten ausschöpfen.