„Die Demokratie befindet sich in einer der tiefsten Krisen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, schreiben Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem jüngsten Buch. Und seit Jahren versuchen die beiden deutschen Soziologen, die an der Universität Basel lehren, zu ergründen, was die Ursachen für diese Krise sind.
Gefunden haben sie sehr viele Menschen, die enttäuscht, aber auch sehr wütend sind. Die das Gefühl haben, es wäre früher alles besser gewesen, sie bekämen nicht, was ihnen zusteht, sie würden bevormundet und von der Politik nicht gehört. Das haben sie den beiden Forschern in großen Umfragen und in ausführlichen Tiefeninterviews erzählt.
Das erste gemeinsame Buch von Amlinger und Nachtwey mit dem Titel „Gekränkte Freiheit“ erschien 2022 und beschrieb, wie sich viele Menschen während der Corona-Pandemie radikalisierten. Vor wenigen Monaten folgte die Studie „Zerstörungslust“, die mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet wurde.
Der scheinbar paradoxe Untertitel des Buchs „Elemente eines demokratischen Faschismus“ hat Debatten und auch Kritik ausgelöst. Amlinger und Nachtwey beschreiben, weshalb immer mehr Menschen unser liberales demokratisches System zerstören wollen – im Namen einer angeblich „wahren Demokratie“. Und warum immer mehr Menschen von Politikern wie Donald Trump fasziniert sind – nicht trotz seiner offenen Aggressivität, sondern gerade wegen ihr.
Für die Ö1-Reihe „Im Gespräch“ habe ich Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey in Basel getroffen. Hier das Transkript zur Sendung:
Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey, Sie haben ein Buch über sehr wütende, zornige Menschen geschrieben. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen – haben Sie mit so vielen wütenden Menschen zu tun?
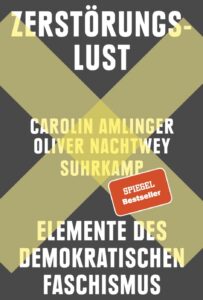
Carolin Amlinger: In gewisser Weise war das eine Fortsetzung auch unseres Nachdenkens über die Nebenfolgen unserer demokratischen und sehr freiheitlichen Gesellschaft, wie wir sie in „Gekränkte Freiheit“ begonnen haben. Dort haben wir uns mit Personen getroffen, die die Corona-Maßnahmen sehr kritisch gesehen haben und die auf der Grundlage dessen einen Generalverdacht gegen die Gesellschaft entwickelt haben und eben im Namen gerade der Freiheit gegen die demokratische Gesellschaft aufbegehrt haben.
Und das hat uns nicht ganz losgelassen, insbesondere auch das Moment der lustvollen Zertrümmerung oder des Beiseitewischens von sozialen Abhängigkeiten. Dieses Moment der Destruktivität hat uns auch durch die Realität wieder eingeholt. Mit einem Blick auf die USA – aber auch nach Deutschland – haben wir gerade gesehen, wie soziale Minderheiten, Migrantinnen verhöhnt wurden, ausgelacht wurden, ausgegrenzt wurden. Das war der Ausgangspunkt, nochmal weiter und tiefer nachzudenken, wie autoritäre Mentalitäten in unserer demokratischen Gesellschaft entstehen.
Jetzt war die Corona-Pandemie natürlich ein ganz besonderer Einschnitt, aber ist diese Aggressivität grundsätzlich neu? Der Philosoph Peter Sloterdijk hat vor knapp 20 Jahren einen berühmten Essay über Zorn als politische Kraft geschrieben. Und Stéphane Hessel hat kurz danach sein populäres Pamphlet „Empört euch!“ veröffentlicht. Sind Wut und Frust und Zorn als politische Kraft neu?
Oliver Nachtwey: Ganz und gar nicht. Die gesamte Geschichte westlicher Demokratien – und möglicherweise auch nicht westlicher Demokratien – wird häufig getrieben von politischen Emotionen. Die Frage ist ja: Worauf richtet sich der Zorn oder wogegen richtet sich der Zorn? Wir kennen ja auch Formen linker Destruktivität. Die deutsche Anarcho-Band Ton Steine Scherben hat in den 1970er Jahren gesungen: „Mach kaputt, was euch kaputt macht“. Das war aber ein Zorn, der sich gegen bestimmte Formen von illegitimer Herrschaft, von grundsätzlicher Ungleichheit gerichtet hat. Deshalb kann Zorn auch in der ArbeiterInnen-Bewegung erst mal ja auch eine Kraft sein, die etwas Positives bewirkt.
Es geht also nicht um den Zorn an sich, sondern es geht wirklich um den Zorn, der ganz stark darauf gerichtet ist, Errungenschaften der Demokratie, Errungenschaften von Gleichbehandlung zu zerstören. Diese Verbindung ist auch nicht ganz neu, aber zumindest ist sie in dieser Kombination etwas Neues nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war die Frage, die uns so beschäftigt hat: Warum sind Menschen so zornig in diesen Gesellschaften, die eigentlich Freiheitsgrade und Wohlstandsgrade ungekannten Ausmaßes erreicht haben?
Nun gibt es in Ihren Interviews mit diesen zornigen Menschen einen durchaus interessanten Widerspruch: Die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, würden nämlich energisch bestreiten, dass sie die Demokratie zerstören wollen. Ganz im Gegenteil: Sie sagen, sie sind die wirklichen Demokraten und Sie wollen eine wahre Demokratie. Wie passt das zusammen?
Nachtwey: Erstmal beschreiben die Leute eine Situation, in der sich die Gesellschaft stark verändert hat. Sie sagen ja, sie wollen nicht die Demokratie abschaffen, beziehungsweise sagen sie, sie sind die wahren Demokraten. Die Faschisten sind die anderen. Häufig sehen sie sich in einer Form der Diktatur, die von Liberalen, Grünen, Sozialdemokraten oder Konservativen ausgeübt wird.
„Sie sehen die Welt als Diktatur“
Diese Form der liberal-konservativen Diktatur macht ihnen lauter Vorschriften. Sei es beim Gendern, sei es bei Formen von Nichtdiskriminierung, sei es beim Rauchen, beim Impfen. Sie sehen sich in einer Gesellschaft, in der Regeln, Normen, Institutionen sie beständig blockieren. Sie kommen nicht vorwärts, weder beim sozialen Aufstieg im wirtschaftlichen Leben noch im privaten Leben. Und das empfinden sie als derart einschnürend, dass sie diese Welt als Diktatur sehen. Sie sagen: Wir sind die Mehrheit, und zwar die Volksmehrheit, und auf uns wird nicht gehört durch diese ganzen liberalen Eliten. Und sie wollen im Grunde diese Volksdemokratie – ein ganz anderer Demokratiebegriff, der sich gerade als Demokratiebegriff versteht, indem er die liberale Demokratie verneint.
Amlinger: Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die waren gar nicht unbedingt alle verzweifelt, resigniert, frustriert – anders als die Personen, mit denen wir noch vor einigen Jahren im Zuge der Corona-Proteste gesprochen haben. Jetzt dominierte eher das Erwecken, die Euphorie, dass endlich Schluss gemacht wird mit unserer liberalen Gesellschaft. Dass endlich die Zeit angebrochen ist, in der eben die Mehrheit wieder zu ihrem Recht kommt.
Und das ist etwas, das uns natürlich in den Gesprächen auch sehr erschrocken hat. Wir haben ja als SoziologInnen mit den Personen gesprochen. Wir haben zuallererst zugehört und ihre Selbsterzählung über das eigene Leben, aber auch über die Gesellschaft sich entfalten lassen. Und das war ein Muster: Die Gesellschaft ist im Niedergang begriffen, sie ist im Untergang begriffen und darum müssen wir sie jetzt zerstören, um etwas Neues aufzubauen.
Damit wir uns mal über die Dimension klar werden: Von wie vielen Menschen reden wir? Sind das ein paar hardcore rechtsextreme Neonazis und Skinheads? Oder reden wir von allen WählerInnen von Parteien wie der AfD oder der FPÖ, also von so 25 bis 35, 40 Prozent der Wählerschaft? Oder sogar von mehr als der Hälfte der Wählerschaft, wie die Wähler von Herrn Orban in Ungarn oder von Herrn Trump in den USA? Von wie vielen Menschen reden wir hier, wenn Sie von diesen Destruktiven sprechen?
Nachtwey: Wir sind ausgegangen von einer Forschung, die in den USA durchgeführt wurde, die sogenannte Need for Chaos-Forschung. Die haben eine Skala aus verschiedenen Fragen entwickelt. Die erste Aussage, wozu Menschen dann sagen konnten Das unterstütze ich oder unterstütze ich nicht, war: Wenn in einem anderen Land eine Naturkatastrophe geschieht, dann bekomme ich einen Kick. Das ist eine …
… absurde Aussage.
Nachtwey: … eine wirklich absurde Aussage. Man liest das und es ist wirklich verstörend und es ist dann kombiniert mit weiteren Aussagen wie: Die Gesellschaft sollte in Schutt und Asche gelegt werden, Sollen sie doch alle untergehen. Und es war gerade diese Vorstellung – wenn anderen ein Leid geschieht, eine Naturkatastrophe geschieht, dass man dann de facto ein Glücksgefühl hat.
Wie viele Menschen haben das?
Nachtwey: 15 Prozent. In einer repräsentativen Untersuchung für die USA. Nicht alle sind Rechtsextreme. Es gibt aber eine große Überschneidung. Es gibt auch einen gewissen Teil an linker Zerstörungslust. Aber man konnte in dieser Forschung sehen, dass vor allen Dingen weiße Männer, die statusambitioniert waren, besonders stark und heftig da drin waren: Ich komme nicht auf den Platz, der mir zusteht. Und dann war man besonders destruktiv.
Wir haben uns diese Forschung zum Vorbild genommen, haben aber nicht dieses Naturkatastrophen-Item übernommen, sondern eine eigene Skala gebildet. Das heißt, wir haben Fragen gestellt wie: In bestimmten Situationen ist Gewalt gerechtfertigt? Aber auch: Sollen sie doch alle untergehen. Oder: Diese Gesellschaft sollte in Schutt und Asche gelegt werden. Und bei unserer Messung kamen wir dann auf 12,5 Prozent. Das klingt jetzt nicht nach sehr viel, aber ist ja eigentlich jeder Achte.
Jetzt sagen Sie schon: 12,5 Prozent klingt auf den ersten Blick nicht so viel. Das würde auch bedeuten, dass knapp 90 Prozent nicht destruktiv sind. Ist das nicht eine gute Nachricht?
Nachtwey: Das sind die Hochdestruktiven, die auf alle diese Fragen geantwortet haben: Unterstütze ich sehr. Und wir können das dann weiter differenzieren. Also, wir können sagen: Das ist die gute Botschaft, 60 Prozent sind gar nicht destruktiv.
Das ist eine solide Mehrheit…
Nachtwey: Das ist eine solide Mehrheit. Jetzt können Sie aber sagen: Die AfD bekommt in Sachsen-Anhalt in diesem Herbst vielleicht 40 Prozent der Stimmen. Und wenn die Grünen und die FDP rausfallen, bekommt sie die absolute Mehrheit der Mandate. Das heißt, in der Demokratie kann sich eine Mehrheit in der Bevölkerung trotzdem nicht politisch manifestieren, wenn es eine so starke Mobilisierung von rechts gibt, dass sie zu einer gewissen Mehrheit der Mandate führt.
„Die Destruktivität kommt auch aus der Mitte“
Amlinger: Und auch die Personen, die in der Umfrage hochdestruktiv waren, waren eben nicht unbedingt radikale Rechte, Neonazis oder Hooligans. Sondern eben auch Personen aus der bürgerlichen Mitte, die sich selbst gar nicht unbedingt als rechts eingestuft haben, aber genau diese destruktive Mentalität entwickelt haben. Das heißt: Was wir gerade beobachten, ist eine politische Bewegung, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt und eben gerade darum auch nochmal eine ganz andere Triebkraft und Antriebskraft entwickeln kann.
Was an Ihrer Untersuchung auch auffällt: Die Destruktiven ziehen sich offenbar ziemlich quer durch die Bevölkerung. Es gibt ein gewisses Übergewicht bei jüngeren Männern, aber es sind genauso Frauen dabei, es sind Ältere dabei, es sind Arbeiter dabei, es sind auch sehr gebildete und gutverdienende Menschen dabei. Hat Sie das überrascht?
Nachtwey: Nicht unbedingt. Es gibt einen berühmten Aufsatz von Theodor Geiger, der geschrieben hat: Der historische Faschismus war die „Panik im Mittelstand“. Aber wir sehen ja jetzt schon eine große Stärke der AfD unter den ArbeiterInnen oder den Personen, die sich als ArbeiterInnen sehen. Das ist eher das überraschend Dramatische: Dass die linken Parteien und die Gewerkschaften so stark den Zugriff auf die Arbeiterinnen verloren haben.
Bleiben wir vielleicht gleich bei dem Begriff Faschismus. Der Untertitel Ihres Buches lautet „Elemente eines demokratischen Faschismus“. Und der wurde in Rezensionen auch viel kritisiert. Die Kritiker sagen zusammengefasst: Sowas gibt es nicht. Sie müssen sich schon entscheiden: Entweder Demokratie oder Faschismus. Was meinen Sie mit demokratischem Faschismus?
Nachtwey: Wir wählen den Begriff ja nicht, um die Kritiker zu erzürnen, sondern das ist bei uns erst mal ein Diskussionsangebot. Weil wir glauben, dass die Gegenwart so widersprüchlich ist wie dieser Begriff. Beziehungsweise versuchen wir einen Begriff zu wählen, der der Gegenwart angemessen ist. Wir haben ja vorhin schon über die Interviews und die Demokratie gesprochen. Was die Menschen selbst in ihrer Identität von sich sagen, ist, dass sie sich für Demokraten halten – für die echten Demokraten halten. Aber gleichzeitig haben sie diese Fantasien von Gewalt, Umsturz, Umsturz zur wahren Demokratie, wo die anderen unterworfen werden. Und sie kommen auch häufig aus der Demokratie selbst. Deshalb wählen wir diesen Begriff.
Wenn man sich die alte NSDAP anschaut: Die hat kein Hehl daraus gemacht, die Demokratie abschaffen zu wollen. Die AfD ist eine Partei, die von konservativen Professoren gegründet wurde und immer noch viele Bürgerliche in ihren Kreisen hat. Gleiches gilt für die [US-]Republikaner. Das heißt: Diese Parteien, diese Bewegungen haben diese Widersprüchlichkeit, sowohl in ihrer Identität als auch in ihrem Ausblick. Was Donald Trump jetzt gerade in den USA macht, das hat viele Elemente von faschistischer Politik. Aber es gibt bisher wenig Anzeichen, dass er Wahlen komplett abschaffen will.
„Rechtspopulismus beschreibt es nicht angemessen“
Amlinger: Es gab schon nach der ersten Amtszeit von Donald Trump eine große Debatte darum, ob man ihn nun als einen Faschisten bezeichnen könne oder nicht. Man hat Trump lange als Rechtspopulisten bezeichnet und das schien auch uns ein Stück weit zu schwach, um eben dieses auch revolutionäre Moment beschreibbar zu machen. Weil der Rechtspopulismus eigentlich eine Reformbewegung ist, die darauf zielt, die „korrupten Eliten“ durch volksnahe Repräsentanten auszutauschen. Und das ist etwas, was die gegenwärtige Rechte aus unserer Sicht nicht mehr angemessen zu beschreiben vermag.
Aber ist das nicht schwierig: Unterstellen Sie damit nicht all diesen Parteien, die auf eine gewisse Weise ideologisch ähnlich, aber doch relativ heterogen sind, dass sie letztlich, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, so regieren würden wie Trump in den USA? Orban regiert in Ungarn schon deutlich länger und mit einer deutlich größeren Mehrheit und Sie sehen dort keine paramilitärischen Organisationen. Es werden auch keine Menschen auf der Straße gezielt ermordet. Das ist eine andere Form von sehr rechter Regierung – von auch autokratischer Regierung. Aber würden Sie das Faschismus nennen?
Nachtwey: Wir stellen keine Theorie des demokratischen Faschismus auf, sondern wir skizzieren ein Spektrum, was dazu gehört. Wir sagen ja auch, dass Viktor Orban und die Fidesz eher zum autoritären Populismus gehören würden. Bis zu einem gewissen Grad gehört auch Giorgia Meloni dazu. Das Ziel unseres Buches ist, diesen Prozess wieder aufzurufen. Diesen Prozess und dieses Spektrum. Die AfD ist ein Teil davon.
Was uns bei der AfD vor allen Dingen interessiert, ist: Warum wählen Menschen diese Partei? Warum wählen Menschen diese Partei, die nicht als vollständig rechtsextreme Partei zu gelten hat, die als bürgerliche Partei angefangen hat und diesen Anteil immer noch hat, aber die vom deutschen Verfassungsschutz – der jetzt ja nicht unbedingt eine linksradikale Organisation ist – als in Teilen gesichert rechtsextrem bezeichnet wird. Und ich glaube, dass das einfach so ist: Dass die AfD ein Hybrid ist aus bürgerlichen Teilen, aber eben auch sehr attraktiv ist für offen Rechtsextreme. Und dass diese Dynamik sich radikalisiert.
Die Antwort auf Ihre Frage, warum wir diesen Begriff wählen, ist: Wir sagen nicht, dass wir da jetzt sind. Aber unsere Botschaft ist: Wenn man jetzt nicht etwas tut, dann kommt man da irgendwann hin. Und im Moment zeigen die Entwicklungen der Gesellschaft in diese Richtung. Deshalb ist das als Warnung zu begreifen – dass wir aber noch was machen können.
Wenn Sie sagen, es interessiert Sie, warum so viele Menschen eine Partei wie die AfD wählen: Warum wählen so viele Menschen eine Partei wie die AfD?
Amlinger: Das hat natürlich sehr vielschichtige Gründe. Die ArbeiterInnen, mit denen wir gesprochen haben, haben vor allen Dingen beklagt, dass ihre eigene harte Arbeit nicht mehr gesehen wird und nicht mehr anerkannt wird. Das waren insbesondere auch ArbeiterInnen, die Ambitionen hatten, nochmal sozial aufzusteigen. Die neben ihrem Job ein Studium begonnen haben und wo sich aber gerade diese Aufstiegsidee nur gebrochen oder gar nicht übersetzen konnte. Die Personen aus den oberen Soziallagen, wie beispielsweise UnternehmerInnen, mit denen wir gesprochen haben, fühlten sich eher in ihrer unternehmerischen Freiheit gegängelt – von all den bürokratischen Regulierungen, den Diversitäts-Auflagen, den Auflagen zum Klimaschutz und wollten wieder mehr ökonomische Freiheit.
„Das Gefühl, im Leben blockiert zu sein“
Wo sie aber zusammengekommen sind und was eben diese gemeinsame Klammer war, ist dieses fundamentale Gefühl, im eigenen Leben und in der Gesellschaft blockiert zu sein, obwohl man doch alles richtig gemacht hat. Obwohl man doch eigentlich Anspruch hat auf eine gewisse Form von Verdienst, Anerkennung, Wertschätzung. Das war ein gemeinsames, einbindendes Motiv.
Der Sozialpsychologe Erich Fromm, auf den wir uns stützen, der hatte genau dieses Gefühl der Blockade auch schon Anfang der 1940er Jahre beobachtet und er hat gerade die Zerstörungswut als ein Ergebnis des ungelebten Lebens bezeichnet. Das ist eine sehr schöne Formulierung, weil er damit eben nochmal den Punkt machen wollte, dass gerade dieses Gefühl, dass die eigenen Potenziale nicht entfaltet werden, umschlagen kann in eine Destruktivität gegen die Gesellschaft, die einem die Lebenschancen vorenthält.
Ein anderes großes Feindbild der Wütenden in ihren Befragungen war auch die politische Korrektheit. Oder wie man seit einigen Jahren sagt: die Wokeness. Viele Menschen – Sie haben es auch schon angedeutet – fühlen sich bevormundet: Sie sollen kein Fleisch mehr essen, kein Dieselauto mehr fahren, nicht mehr rauchen, aber dafür gendern. Aber Vorschriften gab es früher auch schon. Von der Gurtpflicht im Auto über Benimmregeln bis hin zu Geschlechternormen, die früher ja viel strenger waren als heute. Woher kommt dann in den letzten Jahren diese Wut über die Bevormundung?
Nachtwey: Das hat sehr viel mit dem zu tun, was Carolin gerade mit Erich Fromm als das ungelebte Leben beschrieben hat. Und wir nennen das in unserem Buch das Nullsummen-Denken. In der Kurzfassung: In den 50er und 60er Jahren haben Menschen die Gesellschaft als sich öffnend und differenzierend betrachtet. Mein Nachbar hat einen guten Job – und man hat gedacht: Ja cool, es gibt mehr gute Jobs, also bekomme ich auch einen. Der deutsche Soziologe Ulrich Beck hat das mal als den Fahrstuhl-Effekt bezeichnet: Man steht mit den Reichen im Fahrstuhl, aber für einen selbst wird es auch besser. Man hat mehr Urlaub, man hat mehr Geld für einen Urlaub, man kann sich besseren Wohnraum und ein Auto leisten.
Und jetzt hat sich diese Idee der Entfaltung und Öffnung grundsätzlich verkehrt. Man sieht sich blockiert – und das ist das Nullsummen-Denken: Mein Nachbar hat einen guten Job, also gibt es eine gute Job-Möglichkeit weniger. Der Vorteil der anderen ist mein Nachteil. Für mich geht es nicht mehr weiter. Meine Aufstiegsperspektiven sind blockiert.
Mit der Gurtpflicht kommt man vielleicht klar, wenn aus dem Golf ein Mercedes geworden ist. Aber jetzt haben viele Leute das Gefühl: Die Löhne in meinem Unternehmen sind nicht mehr gewachsen, man redet hier aber nur über Gender-Toiletten. Das sind jetzt immer Zitate aus unseren Interviews. Deutschland investiert zu wenig in seine Infrastruktur, hat aber genug Geld für Radwege in Peru. Und das wird immer im Nullsummen-Denken thematisiert, besonders diese Reglementierung.
Amlinger: Diese Logik resultiert eben genau aus einer Weltwahrnehmung, dass es nicht mehr genug für alle gibt. Und das macht es auch besonders gefährlich und explosiv, weil es immer ein existenzieller Kampf um knapp gewordene Ressourcen ist, der in diesem Gefühl der Bevormundungen dann auch mitgeführt wird.
Könnte es auf eine gewisse Weise auch eine Folge der Bildungsexpansion sein? Mein Vater war Hausmeister in einem großen Sozialwohnbau. Meine Mutter war Hausfrau und später Kassiererin in einem Supermarkt. Also ein klassischer Arbeiterhaushalt in den 1970er und 80er Jahren. Und für die „Studierten“, die man primär im Fernsehen damals gesehen hat, gab es zum einen schon eine gewisse Bewunderung und zum anderen fand man die Intellektuellen ein bisschen seltsam und spinnerhaft. Aber man hat sich von ihnen nicht bedroht gefühlt – weil letztlich waren sich meine Eltern und alle Menschen in diesem Hochhaus einig: Wir sind die Normalen. Und die Mehrheit des Landes ist so wie wir und eben keine spinnerten Akademiker. Aber mittlerweile studiert von jedem Jahrgang die Hälfte und viele Menschen aus dem Milieu meiner Eltern haben das Gefühl: Die werden jetzt immer mehr und die schauen auf uns herab und verachten uns und wollen uns sagen, wie wir zu leben haben.
Nachtwey: Ich würde es jetzt nicht ein Resultat der Bildungsexpansion nennen, sondern eher die Modernisierung der Gesellschaft. Es gibt nicht nur mehr Akademiker, sondern es gibt mehr Jobs, die eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft ausüben, die ja ganz vernünftig ist. Es gibt mehr SozialarbeiterInnen, es gibt mehr JournalistInnen wie Sie, Universitätsangehörige wie uns, ÄrztInnen. Und all diese Jobs – wir nennen sie soziokulturelle ExpertInnen – sind Jobs, wo man Leuten auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen häufig hilft, das Leben zu gestalten.
„Der liberale Paternalismus nervt“
Wenn ich zu meiner Ärztin gehe, verschreibt sie mir ein Medikament für meinen Heuschnupfen und sagt aber auch: Herr Nachtwey, nehmen Sie doch mal bitte ein bisschen ab. Das heißt, ich bekomme da einen kleinen Ratschlag. Auch in der Apotheke bekommt man einen Ratschlag. Wenn wir zu unserem Sohn in die Schule gehen zum Elterngespräch, bekommen wir nicht nur ein Feedback über seine Noten, sondern wir bekommen auch ein kleines Feedback, was wir ihm in seine Brotdose hineintun. Da wird man auch gelobt: Ja, Sie haben jetzt hier nicht so viele Süßigkeiten reingetan. Und es gibt Vorschriften, was man wirklich reintun soll, was für Brot und so…
Nervt Sie das dann auch manchmal? Fühlen Sie sich da auch bevormundet?
Amlinger: Also ich glaube, jeder kennt solche Situationen aus dem Alltag, die natürlich nervig sind. Gerade weil man selbst doch die beste Expertin für die eigene Lebensführung ist, denkt man. Aber man muss ja mitbedenken, dass diese gut gemeinten Ratschläge, die so oft als Schläge empfunden werden, ja auch in einer Gesellschaft entstanden sind, die nicht nur sehr viel mehr Risiken produziert, sondern gleichzeitig auch das Individuum nochmal stärker vor diesen Risiken schützen möchte. Es sind also gut gemeinte Ratschläge, die unser Leben, unsere Gesundheit besser machen.
Warum kommen die dann nicht so an, wie sie gemeint sind?
Nachtwey: Natürlich bin ich davon genervt. Ich möchte auch dringend ein ernstes Gespräch mit dem Ingenieur führen, der unseren Trockner entworfen hat, der nämlich nicht aufhört zu piepen, weil es ökologisch oder aus anderen Gründen sinnvoll ist, dass man ihn ausmacht und öffnet, wenn er ans Ende gekommen ist. Was dazu führt, dass wir den Trockner abends nicht mehr anmachen können, weil er piept, während wir schlafen. Und man kann es nicht ausstellen! Es macht mich verrückt!
Es gibt, glaube ich, verschiedene Dinge, die verschiedene Menschen unterschiedlich verrückt machen. Unsere ganze Gesellschaft ist so risikobewusst, aber es gibt auch einfach mehr Risiken. Es gibt eine Form von liberalem Paternalismus und ich verstehe die Leute, dass es sie nervt. Ist jetzt die Antwort darauf: Wir lassen es? Das weiß ich nicht. Wir sind jetzt erst mal die SoziologInnen, die sagen: Wir beobachten das. Und das ist vielleicht auch das, wo ihre Eltern sagen: Wir sind die Normalen und das sind die spinnerten Akademiker, die uns was sagen wollen. Das kann ich soziologisch verstehen.
Wenn Sie sagen, das alles ist zu einem wesentlichen Teil auch eine Verteilungsfrage, weil die Ressourcen knapp werden: Warum richten sich dann der Zorn und die Wut zwar sehr häufig gegen diffuse Eliten, aber sehr selten gegen die Reichen? Das wäre doch eigentlich logisch. Es ist aber nicht so, sondern Superreiche wie Elon Musk oder Milliardäre wie Donald Trump sind ja für die Leute, die Sie beschreiben, eher Vorbilder als Feindbilder. Warum?
Amlinger: Das ist eine Frage, die auf der Hand liegt, die aber gar nicht so einfach zu beantworten ist. Zum einen wird gerade so eine Person wie Elon Musk, der ja sehr bizarr wirkt – auch in seinen Ideen und in seinem messianischen Vorhaben, die Gesellschaft als solche umzugestalten und auch die Grenzen der Menschheit neu zu setzen – die sind sozusagen Idole. Gerade weil sie diese Entfesselung des Erfolgs, die man im eigenen Leben nicht mehr erlebt, auf eine sehr drastische, direkte Art und Weise verkörpern.
Das heißt, diese Mentalität, zu einer Elite zu gehören, obwohl man real missachtet wird, ist ein entscheidender Punkt, warum man affektiv eher mit Reichen, Superreichen koaliert, obwohl die ja ganz real das Leben schwerer machen, gerade für die Personen, die dann Fans sind.
Sie haben 41 Tiefeninterviews geführt und einige Ihrer Gesprächspartner sagen wirklich fürchterliche Sachen, die Sie im Buch zitieren. Sie wollen „das System brennen sehen“. Sie haben furchtbare Aggressions-Fantasien, von der Todesstrafe bis dazu, Migranten über die Grenze hinweg nachzutreten. Sie sind zum Teil extrem rassistisch. Oder Sie sagen, dass Sie in Deutschland in einer Diktatur leben. Wie war es für Sie eigentlich, diesen Menschen zuzuhören?
Amlinger: Wir haben ja schon erwähnt, dass wir das als Soziologinnen getan haben. Und wir haben da eine gewisse Form der methodischen Empathie benutzt: Eines Einfühlens in die Selbsterzählung, ohne dass man sich emotional damit identifiziert oder auch involvieren lässt. Wir wollten erst einmal die Art und Weise verstehen, wie sie auf die Welt blicken, was sie jetzt ungerecht wahrnehmen und was sie uns auch als Lösungen präsentieren. Das heißt, wir waren gezwungenermaßen in der Rolle zuzuhören und nicht zu widersprechen.
„Nach manchen Interviews haben wir Schnaps getrunken“
War das schwer?
Amlinger: Teilweise ist uns das sehr schwer gefallen. Wir haben ja mittlerweile schon einige Interviews geführt und wir sind es auch gewohnt, diese Haltung einer soziologischen Zuhörerin einzunehmen. Gleichwohl geht es einem danach nicht immer gut. Es ist schon etwas, was man dann teilweise mitnimmt nach Hause, das einen noch weiter beschäftigt. Wir konnten das aber immer ganz gut übersetzen, auch in einen theoretischen Erkenntnisprozess, weil es waren eben nicht radikal rechte Personen, mit denen wir gesprochen haben, sondern ganz normale Menschen, wie sie vorhin formuliert haben. Und genau das zum Ausgangspunkt zu nehmen und zu fragen: Was ist denn das für eine Normalität, die ganz normale Menschen so unnormale Aussagen treffen lässt? Das führt dann auch ein bisschen wieder aus diesem Gefühl, nichts erwidern zu können, und aus dieser Ohnmacht heraus. Das kann man dann wieder theoretisch produktiv umsetzen und fruchtbar machen.
Nachtwey: Es gibt immer so diesen ersten Moment, dass man die Menschen am Anfang interessant findet. Sie versuchen sich am Anfang ja auch immer als Personen zu präsentieren. Es ist eine künstliche Situation, in der sie den WissenschaftlerInnen auch erklären wollen, warum sie so denken, wie sie denken. Sie haben ja häufig die Erfahrung gemacht, dass sie sonst in ihrem Umfeld viel Widerstand erfahren. Und bei uns haben sie das Gefühl, sie können frei reden. Wir konstruieren einen Raum, wo sie das Gefühl haben, sie können frei reden. Und am Ende ist es dann sehr intensiv.
Im Grunde kommen die starken rassistischen Aussagen ganz am Ende. Und ich glaube, du [Carolin] hast es sogar immer ein bisschen besser weggesteckt. Also, ich bin nach so einem Interview … mir geht das sehr lange durch den Kopf. Und ich habe schon das Bedürfnis, einen Schnaps zu trinken. Ich habe das auch ab und zu gemacht. Man schaut da natürlich irgendwo rein, wo man im normalen Leben vielleicht nicht so genau hinschauen wollen würde.
Amlinger: Also ist die Forschung zu Autoritarismus auch nicht unbedingt gut für die eigene Gesundheit …
Nachtwey: Ich habe teilweise mit dem Assistenten im Auto gesessen und wir haben Schnaps getrunken. Nicht der Fahrer, natürlich! Aber es war ein Element, wo wir dann auch später immer nochmal wieder drauf zurückkommen mussten. Nicht wie ein traumatisches Erlebnis, aber man musste es verarbeiten.
Ich würde noch für eine Frage bei Ihnen persönlich bleiben. Sie sind ja nicht nur ein Autoren-Duo, sondern seit vielen Jahren schon auch privat ein Paar. Macht das die gemeinsame Forschung und das gemeinsame Schreiben schwerer oder leichter?
Nachtwey: Viel leichter!
Amlinger: Das war die richtige Aussage. (lacht) Wir haben ja jetzt auch das zweite Buch zusammengeschrieben.
Und Sie sind noch immer zusammen.
Amlinger: Und wir sind noch immer zusammen. Das zeigt ja schon mal, dass sowohl privat als auch wissenschaftlich gesehen eine gute Co-Autorschaft möglich war. Mittlerweile ist es so, dass man sich tatsächlich – das ist gleichzeitig aber auch der Nachteil – in so einem gemeinsamen, kollaborativen Denkstrom befindet, aus dem man aber auch schlechter raustreten kann, weil die Arbeit ja überall ist, wo der Partner ist: Am Frühstückstisch, in den Abendstunden. Und gerade wenn uns was umtreibt, ist es manchmal auch entgrenzt. Also das Bedürfnis, da eine Grenze zu ziehen, ist dann zwar auch da, aber es ist schwerer, das zu realisieren.
„Social Media sind ein Symptom, keine Ursache“
Was mir an Ihrem Buch und auch jetzt in unserem Gespräch auffällt, ist, dass die Digitalisierung und Social Media für das, was Sie beschreiben, sehr wenig Rolle spielen. Nun hat der US-Satiriker Jon Stewart, den Sie sicher kennen, eine ganz interessante Erklärung für den Erfolg von Donald Trump. Stewart sagt: Der Erfolg von Donald Trump ist die Unzufriedenheit eines analogen Systems in einer digitalen Welt. – Und vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass der Aufstieg dieser rechten, rechtspopulistischen, rechtsnationalistischen Parteien in der ganzen Welt ziemlich genau mit der Verbreitung von Social Media zusammenfällt. Das spielt aber in Ihrem Buch sehr wenig Rolle. Warum?
Amlinger: Das war schon auch eine bewusste Entscheidung, dass wir die sozialen Medien nicht ins Zentrum setzen, weil sie für uns nochmal ein Symptom sind, aber keine Ursache. Wir gehen eben nochmal stärker davon aus, dass diese Unzufriedenheit, die Sie erwähnt haben, und damit auch der Hass offline entstehen, aber natürlich auch online verbreitet wird und verstärkt wird – das wollen wir gar nicht leugnen: Dass es auch digitale Radikalisierungen geben kann. Aber es kann sie nur geben, wenn mit der analogen Gesellschaft etwas grundsätzlich falsch läuft.
Das heißt, gerade diese Idee – die sozialen Medien haben einen Rechtsruck wahnsinnig mitverursacht – sehen wir sehr kritisch. Weil wir die Individuen als aktiv handelnde Individuen wahrnehmen, die sich dann doch nicht so leicht von Medien verblenden lassen, sondern das als Mittel nutzen, um sich selbst zu ermächtigen; um sich selbst zu souveränisieren, weil – und das ist jetzt ein Zitat von Erich Fromm –, weil man in der Realität so ein mickriger Wurm ist.
Nun kommen Sie ja beide aus einer marxistischen Tradition und da gibt es den berühmten Satz vom Umschlagen von Quantität auch in Qualität. Und da könnte ich auch eine andere These aufstellen. Nämlich, dass es auch schon vor 30, 40 Jahren in jedem Dorf und an jedem Stammtisch wütende Menschen gab, die mal spätabends betrunken gegrölt haben „Unterm Hitler hätt‘s das nicht gegeben!“. Und die hat dann um zwei, drei in der Früh irgendwer aus dem Dorf nach Hause gebracht. Aber niemand hat die ernst genommen. Die waren isoliert und konnten keine politische Kraft entwickeln. Aber seit es Social Media gibt, können sich diese Menschen online vernetzen und bemerken, dass sie gar nicht alleine sind. Und dass sie gar nicht so wenige sind, weil es im nächsten Dorf und im übernächsten Dorf auch welche gibt. Plötzlich sind sie eine sehr große Facebook-Gruppe und fühlen sich dadurch auch mächtiger. Werden lauter und stacheln sich gegenseitig immer weiter auf. Und nun gibt es seit einigen Jahren auch noch etwas, das es sehr lange nicht gegeben hat: Nämlich bei Wahlen ein politisches Angebot für sie auf dem Stimmzettel. Parteien, die genau diese Wut und diesen Frust bewirtschaften. Hat da Social Media nicht tatsächlich auch qualitativ etwas verändert?
Nachtwey: Hat es natürlich. Aber es gab eben auch in diesen Dörfern die Perspektive, dass die Leute sich noch deutlich verstärkter eine eigene Existenz aufbauen konnten. Dass sie die Möglichkeit auf sozialen Aufstieg hatten. Die Kinder gingen zur Universität. Diese alte Gesellschaft, die Sie jetzt aufgerufen haben, war ja erst mal eine Gesellschaft mit Wachstum, sozialer Differenzierung, Verbesserung der Jobs, Verbesserung der Infrastruktur.
Und jetzt sehen die Menschen in den Dörfern, dass die Infrastruktur kaputt geht. Die Buslinien werden eingestellt, die Bahnhöfe werden zugemacht. Das ist konkret so, in den Dörfern, da wo ich herkomme. Der Bus fährt weniger, der Bahnhof bei uns ist tatsächlich mit Brettern zugenagelt. Dort gibt es – aus der Sicht dieser Person – die Erfahrung einer niedergehenden Gesellschaft. Das erhöht erst mal den Anteil der Menschen, die unzufrieden sind, massiv. Und es ist nicht nur die Möglichkeit, sich zu vernetzen.
Amlinger: Dass die Radikalisierung im Netz vor allen Dingen eine männliche Radikalisierung ist, ist eben auch kein Zufall. Dass gerade eine Personengruppe, die in den letzten Jahrzehnten real Privilegien und Status eingebüßt hat, nun im digitalen Raum einen Ort gefunden hat, um sich von den „Fesseln der Gleichberechtigung“ zu befreien und sich sozusagen auch wieder zu ermächtigen gegen die Frauen. Das spiegelt eben auch reale gesellschaftliche Entwicklungen, die nicht nur Rückschritte produzieren, sondern auch Fortschritte. Aber das geht auch einher mit einem empfindlichen Abbau von Status und Privilegien, insbesondere für Männer.
Nachtwey: Es gibt so viele soziale Umbrüche, die da hineinspielen, dass wir dieser These – es ist die Digitalisierung – nicht mehr Gewicht geben wollen, als sie real hat. Man darf auch nicht vergessen, dass ja zum Beispiel gerade die Digitalisierung am Anfang nicht der Rechten Vorschub geleistet hat, sondern der Selbstorganisation von progressiven Bewegungen. Denken Sie an die Occupy-Bewegung oder an den Arabischen Frühling. Das ist bis zu einem gewissen Teil auch ein Medium, wo ganz unterschiedliche Organisationselemente stattfinden können. Jetzt sehen wir gerade – über die verschiedenen Algorithmen, über Musk und so weiter –, dass es tatsächlich sehr starke rechte Ökosysteme sind. Aber das muss nicht zwangsläufig so bleiben.
„Erschöpfung ist das große Thema“
Steffen Mau, ein sehr bekannter deutscher Soziologenkollege von Ihnen, hat den Ausdruck geprägt: Veränderungserschöpfung. Ist das etwas, mit dem Sie was anfangen können?
Amlinger: Das nehmen wir auch auf und schließen uns dem an. Sie haben ja gerade sehr schön geschildert, wie man sich auch in Ihrer Familie selbst als ganz normal bezeichnet hat. Wie aber gerade in der Gegenwart diese Idee der Normalität in Zwang gerät – und zwar in doppelter Hinsicht. Zunächst einmal ökonomisch: Dass es schwerer geworden ist, sich ein normales Leben zu leisten, ein Eigenheim zu erwerben.
Auf der anderen Seite ist die Normalität aber auch normativ brüchig geworden. Gerade diese Idee einer heterosexuellen Kleinfamilie oder auch die Idee des Autos mit Verbrennermotor – das ist in der Gegenwart moralisch umstritten. Und gerade diejenigen, die sich noch sehr stark damit auch als Ideal für ihr eigenes Leben identifizieren, fühlen sich erschöpft durch diese Veränderungen, die in den letzten Jahren passiert sind.
Man darf nicht außer Acht lassen, dass unsere Gesellschaft in einigen Bereichen sehr viel fortschrittlicher geworden ist. Das ist ja auch etwas, das Hoffnung macht, was aber auch dazu führt, dass es da Gegenbewegungen gibt: Die das eben rückgängig machen wollen, weil sie das Gefühl haben, ach, dann ist ja wieder alles ganz normal. Dass aber diese Normalität auch nicht mehr wünschenswert ist und auch gar nicht mehr reaktualisiert werden kann, wird dann ausgeblendet.
Nachtwey: Veränderungserschöpfung – ich glaube, da spielt die Digitalisierung nochmal eine deutlich größere Rolle. Meine Mutter war erst Kassiererin in einer Sparkasse, später hat sie die Überweisungsträger eingetippt. Diese Tätigkeiten gibt es gar nicht mehr wirklich. Die haben sich – in den Jahren, in denen ich das in meiner Kindheit beobachten konnte – so stark verändert, immer wieder transformiert, bis sie später abgeschafft wurden. Man sieht in so vielen Bereichen, dass immer ein Anpassungsdruck da ist. Und das sieht man mittlerweile auch sehr gut in den Daten: Erschöpfung ist das große Thema.
Alle klagen über Belastungssymptome und die Zukunft verdunkelt sich auf vielfache Art und Weise: Klima, Kriege, Job-Veränderungen. Und ja, wir glauben auch, dass das sehr stark zur emotionalen Entzündlichkeit der Gesellschaft beiträgt.
„Faktenchecks bringen nichts“
Wenn Sie sagen: Emotionale Verdunkelung oder Verdunkelung der Zukunftsaussichten … Ich muss ja gestehen, mich hat Ihr Buch deprimiert. Weil das, was Sie beschreiben, auf eine gewisse Weise auch so unausweichlich und ausweglos wirkt. Letztlich sagen Sie ja: Die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft – jedenfalls so, wie wir sie momentan organisieren – produzieren quasi zwangsläufig diese Wut und den Wunsch, sie zu zerstören. Und was Ihrer Meinung nach nicht hilft – und das deprimiert mich als politischen Journalisten natürlich ganz besonders – ist Aufklärung, also politische Bildung. Sie schreiben: Faktenchecks sind sinnlos. Warum?
Amlinger: Na ja, zum einen sind sie sinnlos, weil gerade der Faschismus immer schon eine Gefühlsstruktur war, die sich gegen Widersprüche abgedichtet hat. Viele folgen Trump eben nicht trotz seiner Lügen, sondern wegen seiner Lügen. Er kann es eben. Er kann öffentlich Lügen formulieren und präsentiert sich dadurch als starker Mann, der für seine Anhängerschaft umso attraktiver wirkt Das hat uns eben zum einen dazu bewogen, zu sagen: Faktenchecks bringen nichts.
Zum anderen ist es auch so, dass es eben keine Frage des falschen Wissens ist oder der mangelnden Aufklärung, sondern dass wir tiefer ansetzen müssen – und erst einmal auch die Krisen der liberalen Demokratien offen aussprechen müssen. Um das Gefühl, dass sich alles zusammengezogen hat – dass der Horizont der Zukunft sich derart verdunkelt hat –, nochmal in seinen Gründen und Ursachen zu thematisieren. Um dann vielleicht auch eine andere Zukunft zu entwerfen, die nicht unbedingt darin enden muss, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr Teil dieser Zukunft sein soll.
Sie schreiben im Buch, Sie sind als Soziologen Experten für die Probleme und nicht für die Lösungen. Aber trotzdem: Wenn es politische Aufklärung nicht ist, was ist dann die Lösung?
Nachtwey: Ganz so hart ist es ja nicht. Wir sagen ja nicht, Faktenchecks nützen gar nichts. Also, ich finde Faktenchecks ganz gut, auch für mich.
Ich glaube, in Ihrem Buch steht der Satz: Faktenchecks sind sinnlos …
Nachtwey: … sind sinnlos zum Bekämpfen der Rechten. Aber man muss mal fragen: Sind Faktenchecks nicht auch ganz angemessen, wenn Friedrich Merz über die Innenstädte spricht, wenn Angela Merkel über Alternativlosigkeiten spricht oder wenn Olaf Scholz das in der Vergangenheit gemacht hat?
Worauf ich hinaus will, ist: Was wir schon bräuchten, wäre eine Form von Selbstkritik. Der Liberalismus hat sich in seiner Krise immer mehr abgedichtet und gesagt: Wir brauchen gar keine demokratische Diskussion, sondern das ist jetzt ein Sachzwang, den wir haben: Der Staat muss sparen. Aber dann gab es sowohl bei der Finanzkrise, bei der Flüchtlingskrise, der Corona-Krise und der Ukraine-Krise doch immer sehr viel Geld. Und ich sage gar nicht, dass diese Entscheidungen falsch sind. Im Zweifel finde ich sie jeweils richtig. Ich sage nur, dass politische Entscheidungen als Sachzwänge dargestellt werden. Und das ist natürlich etwas, das Menschen in der Demokratie doch vielleicht auch entfremdet.
Es wird dann den Leuten auch häufig gesagt: Ihr beklagt euch über eure Abstiegsängste, aber die letzten fünf Jahre sind die Löhne im Durchschnitt angestiegen. Das sind sie, aber im Durchschnitt. Da zählen auch immer die oberen Einkommensklassen mit hinein. Das heißt, wir brauchen einen eigenen, besseren, differenzierteren Umgang mit der Realität, der auch auf die Emotionen der Menschen, die sich ja über Jahrzehnte angestaut haben, besser eingeht. Der nicht nur sagt: Ich weiß es aber ein bisschen besser.
Und es gibt auch eine andere Form der Politik. Wir waren sehr abstrakt in unserem Buch, aber Zohran Mamdani, der neue Bürgermeister von New York, hat den Leuten ja relativ einfache sozialdemokratische Versprechen gemacht: Ein öffentlicher Nahverkehr, der funktioniert und umsonst ist. Schulen, die funktionieren. Kitas, die umsonst sind, und Supermärkte, die bezahlbare Lebensmittel haben. Aber er hat das Versprechen auch mit einer Form von Kommunikation verbunden, nämlich: Es geht um euch, New YorkerInnen! Es geht um alle Menschen, die in dieser Stadt leben. Wir machen das Leben für euch konkret besser und ihr seid Teil davon! Das war wirklich eine Politik des Lebens, die sehr viele Menschen begeistert hat. Deshalb sind wir gar nicht so düster. Nur gab es Mamdani noch gar nicht, als wir das letzte Kapitel geschrieben haben, sondern es war bei uns noch sehr abstrakt.
„Eine ganz andere utopische Idee von Gesellschaft“
Sie haben Mamdani aber in einigen Interviews erwähnt und er ist ja auch ein eindrucksvolles Beispiel. Andererseits: Mamdani hat – und das ziemlich knapp – eine Wahl in einer super-demokratischen Stadt gewonnen, in der es für einen Demokraten eher schwierig ist, eine Wahl zu verlieren. Und es sind sich eigentlich alle Kommentatoren in den USA einig, dass er außerhalb einer so großen kosmopolitischen Stadt wie New York völlig chancenlos wäre, weil ihn im Mittleren Westen oder im Rust Belt die meisten Wähler für einen unwählbaren muslimischen Kommunisten halten würden. Taugt er da wirklich so gut als Beispiel?
Amlinger: Ich glaube, er taugt zunächst einmal als Beispiel für einen Hoffnungsträger. Er hat unglaublich vielen DemokratInnen auch außerhalb der USA Hoffnung gemacht, dass man wieder Mehrheiten mobilisieren kann – und zwar mit einer Politik, die nicht auf Kompromisse raus ist, die nicht darauf raus ist, die Narrative der Rechten nachzuerzählen. Die auch nicht sagt: Ja, ihr müsst mehr leisten, den Gürtel enger schnallen – sondern die eben nochmal eine ganz andere utopische Idee von Gesellschaft formuliert. Und die funktioniert hat, um gerade auch dieses affektive Moment der Entfesselung des Imaginationsvermögens – das die Rechte so gut bespielt hat in den vergangenen Jahren – wieder nach links zu rücken. Und ich glaube, in dieser symbolhaften Figur – als Hoffnungsträger für eine grundlegend andere Politik – ist er auch über die USA hinaus nicht zu unterschätzen.
Jetzt habe ich schon gesagt, dass mich Ihr Buch deprimiert hat. Wie ist es denn Ihnen mit Ihren Erkenntnissen gegangen, als Sie das aufgeschrieben haben – emotional?
Amlinger: Momentan ist es sogar so, dass wir wieder mehr Hoffnung haben als nach dem unmittelbaren Beenden des Buches. Auch weil wir das Gefühl haben, dass gerade das Registrieren, dass man eine Veränderung braucht und diese herbeiführen muss, jetzt nochmal stärker im öffentlichen Diskurs angekommen ist. Das ist etwas, wo wir nochmal eine Chance sehen, dass es nicht so kommen muss, wie wir es so düster skizziert haben. Sondern dass unser Buch eben auch die Funktion hatte, wachzurütteln und zu sagen: Der demokratische Faschismus ist keine Ordnung, er ist eine Bewegung. Und eine Bewegung kann aufgehalten werden, kann sich auch wieder hin zur Demokratie entwickeln. Und das ist etwas, wo wir momentan, glaube ich, nochmal ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken.
„Als SoziologInnen haben wir die Hoffnung nicht verloren“
Nachtwey: Ich bin sowieso eher der positive Mensch in dieser Hinsicht. Im Buch steht ja auch eine Lesart drin, die sagt: Wenn wir sozioökonomisch wieder etwas ändern, wenn wir die Gesellschaft wieder offener gestalten, wenn wir darüber nachdenken, was denn jetzt mit diesem Paternalismus ist, der an jeder Ecke erscheint – wenn wir damit Umgänge finden und nicht nur einfach sagen: Weiter so! – dann ist eine Umkehr durchaus möglich. Weil wir es eben soziologisch-gesellschaftstheoretisch fundiert haben. Da gibt es schon einen gewissen Optimismus in diesem Buch.
Aber dieser Optimismus ist nicht einfach zu erlangen, sondern man muss tatsächlich eine systematische Umkehr vollziehen. Und die würde dann auch heißen, man kann mit den Milliardären so nicht weitermachen. Man kann mit der Ungleichheit so nicht weitermachen. Man kann so mit der Marktgesellschaft nicht weitermachen. Das steckt in dem Buch drin und das ist dann vielleicht eine radikalere Implikation. Das ist nicht hermetisch.
Amlinger: Das Schöne ist ja, dass die Soziologie eigentlich eine sehr optimistische Wissenschaft ist. Weil sie strukturell immer davon ausgeht, dass Gesellschaften durch unser Handeln erzeugt werden, und insofern aber auch ein politischer Wandel immer möglich ist. Also, als SoziologInnen haben wir die Hoffnung nicht verloren.
Sie haben einen gemeinsamen Sohn im Volksschulalter. Glauben Sie, dass er als Erwachsener in einer stabilen Demokratie leben wird?
Nachtwey: Wenn genug Leute unser Buch lesen … (beide lachen)
Nein, es ist wirklich schwer zu prognostizieren. Jetzt versuchen wir eher, unseren Sohn im frühen Kindesalter davor zu schützen – obwohl wir am Küchentisch zu viel über Trump sprechen –, sondern ihm eine Kindheit zu bieten, wo er emotionale Stabilität erreicht und vielleicht mit den zukünftigen Herausforderungen gut umgehen kann. Das ist das, was wir tun können.
Amlinger: Das Interessante ist ja, dass gerade die jetzige Kinder-Generation so demokratisch erzogen wird wie noch nie. Und dass sie auch dementsprechende Ansprüche an uns Eltern und an die Gesellschaft formuliert, angemessen und würdevoll behandelt zu werden. Dass genau diese Generation in so eine dunkle Gegenwart hineingeboren wurde, das ist ein wenig tragisch. Aber das sind ja diejenigen, die in Zukunft auch die Welt gestalten werden.
Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey, danke für das Gespräch!

