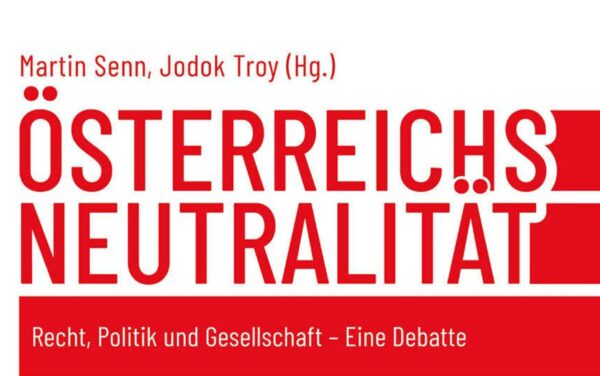Die österreichische Neutralität wurde erst zehn Jahre nach der Gründung der Zweiten Republik beschlossen und ist kein „Baugesetz“ der Verfassung. Der Nationalrat könnte sie jederzeit mit einer Zweidrittel-Mehrheit wieder abschaffen – so wie sie auch eingeführt wurde. Eine Volksabstimmung wäre formal nicht nötig. Und doch wäre das undenkbar.
Denn wohl kaum etwas hat die Identität der Zweiten Republik so sehr definiert wie unsere „immerwährende Neutralität“ nach dem Vorbild der Schweiz. Auch wenn Österreich das Vorbild schon nach wenigen Wochen hinter sich ließ und – anders als die Schweiz – schon im Dezember 1955 UNO-Mitglied wurde. Seit dem EU-Beitritt 1995 und der Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, hat sich die Neutralität Österreichs nochmal grundlegend verändert. Und spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine stellt sich für viele Fachleute die Frage, ob sie noch zeitgemäß ist.
Wirklich geführt wird diese Debatte jedoch nicht. In der Bevölkerung ist die Neutralität unverändert populär – in jeder Meinungsumfrage sind zwei Drittel bis drei Viertel der Befragten dafür. Dementsprechend gering ist auch die Lust von Politiker·innen, sich der Debatte zu stellen. Oder wie 2022 der damalige Kanzler Karl Nehammer verkündete: „Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben“. Immerwährend halt.
Nun haben allerdings mehr als 20 Politolog·innen, Völkerrechtler·innen und Diplomaten einen sehr lesenswerten Sammelband zur (österreichischen) Neutralität vorgelegt, der sie in 23 Kapiteln umfassend analysiert – von ihren historischen Grundlagen, ihrer ethischen Dimension, ihrer rechtlichen Verankerung und ihrer Weiterentwicklung bis zum Vergleich mit der Schweiz, Irland, Malta und mit Schweden und Finnland, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ihre Bündnisfreiheit zugunsten eines NATO-Beitritts aufgaben. (Aus dem Beitrag des Verfassungsjuristen Peter Bußjäger lernt man übrigens, das zwar die Abschaffung der österreichischen Neutralität formal ohne Volksabstimmung möglich wäre, nicht jedoch ein Beitritt zur NATO.)
Und das Tollste an dem Buch – der gesamte 415seitige Band steht frei verfügbar als PDF im Netz. Große Empfehlung!